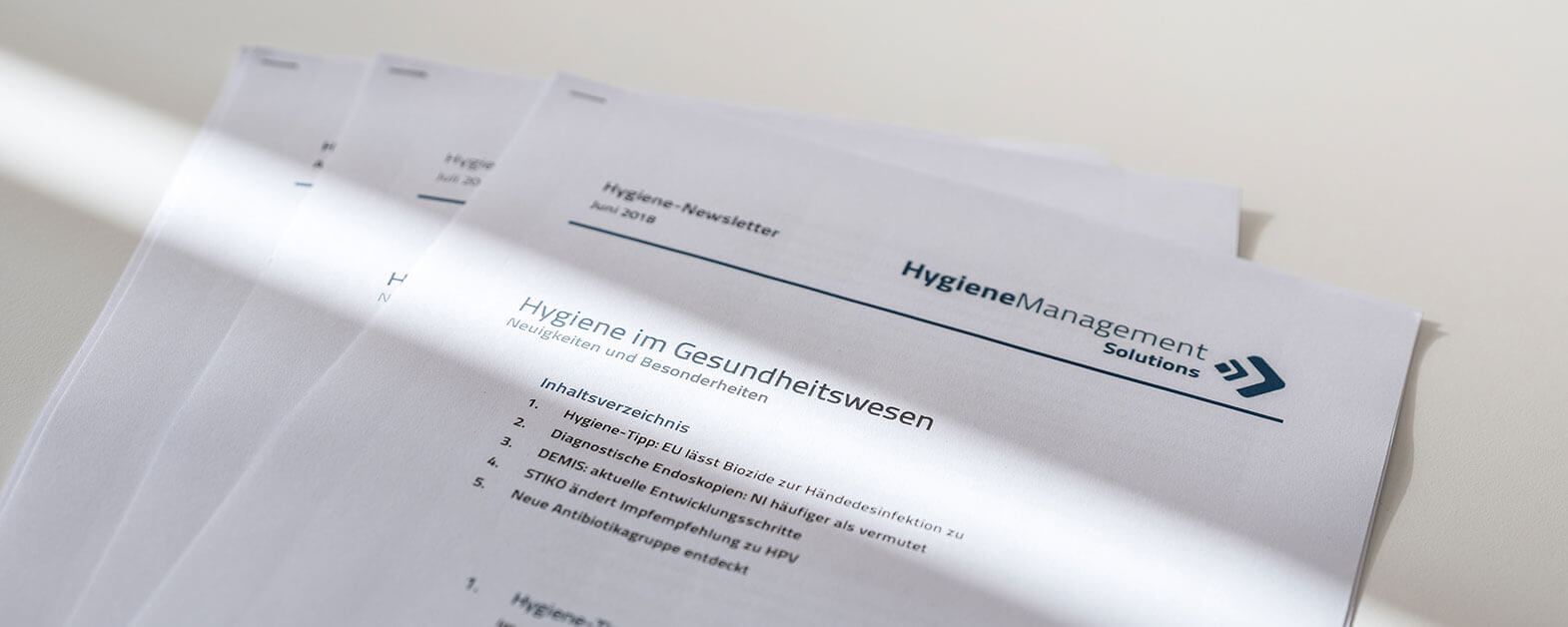HygSo-Hygienenews September 2025
1. DGKH: Beratungsumfang in Einrichtungen der stationären Pflege
Die Mitteilung der DGKH-Sektion „Hygiene in der ambulanten und stationären Pflege/Rehabilitation“ bietet praxisorientierte Orientierung zur Ermittlung des infektionshygienischen Beratungsbedarfs in Einrichtungen der stationären Pflege und Eingliederungshilfe. Sie erklärt die Grundlagen der Risikobewertung und gibt konkrete Berechnungsvorschläge für den erforderlichen Beratungsumfang.
Hygienefachkräfte übernehmen zentrale Aufgaben wie das Erkennen, Überwachen und Steuern hygienischer Prozesse, die Erstellung und Fortschreibung von Hygieneplänen, die Durchführung von Schulungen sowie die Beratung der Einrichtungen. Hygienebeauftragte unterstützen die Umsetzung der Hygieneanforderungen, koordinieren interne Prozesse, übernehmen teilweise Aufgaben der HFK und fungieren als interne Ansprechpartner. Die Rollen können sich je nach Struktur und Personal überschneiden.
Die in der DGKH-Empfehlung beschriebene Ermittlung des Beratungsbedarfs erfolgt nicht allein nach Bettenzahl, sondern orientiert sich am infektionshygienischen Risikoprofil jeder Einrichtung. Wichtige Ausgangswerte sind der Pflegegrad und die Anzahl der Bewohner. Beide Faktoren ergeben einen sogenannten Komplexitätswert, der als Grundlage für die Berechnung des HFK-Beratungsumfangs dient.
Die Empfehlung legt einen Mindestberatungsumfang durch Hygienefachkräfte von zwei Beratungstagen (16 Stunden) pro Jahr für jede stationäre Einrichtung fest – egal ob Pflegeheim mit 80 Plätzen oder ambulante Intensivpflege-WG mit 10 Betten. Der Beratungsumfang steigt zudem mit zunehmendem Komplexitätswert. Zusätzliche Beratungskapazitäten sind für Funktionsbereiche wie Wäscherei oder Küchen einzuplanen. Der Beratungsbedarf sollte mindestens einmal jährlich überprüft und angepasst werden.
Für Hygienebeauftragte wird ein Stundenkontingent von mindestens einem Arbeitstag pro Monat bestätigt. Der sinnvolle Umfang hängt von den Qualifikationen, Aufgaben, der Einrichtung und der Unterstützung durch HFKs ab. Gegebenenfalls sind mehrere Hygienebeauftragte oder weitere hygieneverantwortliche Mitarbeiter notwendig.
Wichtig: Die Empfehlung gilt für Einrichtungen, die aus gesetzlicher Sicht eine Beratung durch eine Hygienefachkraft aufgrund einer Pflegehygieneverordnung brauchen.
Weiterführender Link:
https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/2025_09_24_DGKH_Bewertung%20infektionshygienisches%20Risikoprofil%281%29.pdf
2. Hygiene-Tipp: Sterilverpackungen
In vielen Einrichtungen wird darüber nachgedacht, bei der Dampfsterilisation von OP-Instrumenten in Containern auf eine zusätzliche Vliesverpackung zu verzichten. Fachliteratur zu diesem Thema liegt zwar nicht vor, jedoch wird in vielen Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte (AEMP) bereits seit Jahren, vor allem aus Kostengründen, ohne zusätzliche Innenverpackung gearbeitet.
Für die Sterilität selbst ist das Vlies nicht entscheidend, da der Container als zugelassenes Sterilbarrieresystem fungiert. Bedeutung hat es jedoch für die Trocknung und die aseptische Entnahme der Instrumente. Daher sollte vor einer Umstellung geprüft werden, ob die Container nach dem Sterilisationsprozess auch ohne Vlies im Inneren vollständig trocken sind. Vlies kann Restfeuchtigkeit aufnehmen und so eine schnelle Trocknung unterstützen. Ggf. ist eine Verlängerung der Trocknungszeit im Sterilisator erforderlich.
Darüber hinaus muss geklärt werden, ob das OP-Personal die Instrumente auch ohne die gewohnte Vliesabdeckung, die üblicherweise über die unsterile Außenseite des Containers gelegt wird, aseptisch entnehmen kann und hierfür entsprechend geschult ist.
Weiterführender Link:
https://www.bdc.de/hygiene-tipp-sterilverpackung/?parent_cat=250
3. Verstärkung von Antibiotikaresistenzen durch Schmerzmittel
Ibuprofen und Paracetamol gehören zu den häufig verwendeten frei erhältlichen Schmerzmitteln. Laut einer australischen Studie könnten sie jedoch die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen begünstigen. Die Forschenden beobachteten diesen Effekt in Untersuchungen mit dem Breitbandantibiotikum Ciprofloxacin und dem Bakterium Escherichia coli.
Ein australisches Forschungsteam untersuchte im Labor, ob gängige, nicht antibiotische Medikamente, wie sie häufig in Alten- und Pflegeheimen verordnet werden, die durch Ciprofloxacin ausgelöste Mutagenese bei E. coli verstärken können. Getestet wurden unter anderem Schmerz-, Schlaf- und Blutdruckmittel. Besonders Ibuprofen und Paracetamol führten zu einer deutlich erhöhten Mutationsrate und stärkeren Ciprofloxacin-Resistenz, was durch Veränderungen in den Genen GyrA, MarR und AcrR bestätigt wurde. Wurden beide Medikamente kombiniert, verstärkte sich dieser Effekt noch.
Die Studienleiterin Rietie Venter (University of South Australia) betonte, dass diese Ergebnisse vor allem im Kontext der Polypharmazie in der Altenpflege relevant seien, wo ältere Menschen oft mehrere Medikamente gleichzeitig erhalten. Dies könne die Entstehung von Antibiotikaresistenzen im Darm begünstigen. Die Forschenden sehen darin einen klaren Hinweis, die Risiken der gleichzeitigen Einnahme verschiedener Arzneimittel kritisch zu prüfen.
Weiterführender Link:
https://www.aerzteblatt.de/search/result/161539b0-a426-42af-a621-1f3bbe61c485?q
4. Ausbreitung von Candidozyma auris in Europa
In Europa und besonders in Deutschland, steigt die Zahl der Infektionen mit dem multiresistenten Hefepilz Candidozyma auris (C. auris) weiter deutlich an, wie das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) berichtet.
Das ECDC warnt, dass die Zahl der Fälle mit dem multiresistenten Hefepilz C. auris in Europa stark zunimmt und für Patientinnen, Patienten und Gesundheitssysteme ein ernstes Risiko darstellt. Zwischen 2013 und 2023 wurden in den EU- und EWR-Staaten 4.012 Infektionen registriert, mit einer deutlichen Zunahme in den letzten Jahren. Besonders betroffen sind Spanien, Griechenland, Italien, Rumänien und Deutschland.
In Deutschland traten erste Nachweise 2015 nach Krankenhausaufenthalten im Ausland auf, seit 2021 gibt es auch Übertragungen im Inland. 2023 wurden 77 Primärnachweise gemeldet – mehr als sechsmal so viele wie im Vorjahr. Der Großteil betrifft Kolonisationen, Infektionen sind seltener, Todesfälle wurden bisher nicht dokumentiert. Fachleute betonen jedoch, dass Ausbrüche schwer einzudämmen sind, da Kontaktpersonen oft lange isoliert werden müssen.
C. auris ist für immungeschwächte Menschen gefährlich und kann lebensbedrohliche Blutstrominfektionen sowie hartnäckige Biofilm-assoziierte Infektionen an Implantaten oder Kathetern verursachen. Internationale Daten zeigen Sterblichkeitsraten bis zu 40%, in Deutschland bisher ohne Todesfälle. Die Bekämpfung ist schwierig, da der Pilz auf Oberflächen überlebt und levurozide Präparate teils nicht ausreichend wirken. Zudem sind viele Stämme gegen gängige Antimykotika resistent, auch wenn die meisten Isolate hierzulande noch behandelbar sind. Neue Wirkstoffe befinden sich in Entwicklung.
ECDC und deutsche Expertinnen und Experten fordern eine frühe Erkennung, konsequente Isolations- und Hygienemaßnahmen sowie nationale Koordination, um die Ausbreitung einzudämmen. Während einige Länder Ausbrüche erfolgreich kontrollieren konnten, verfügen bislang nur wenige über Leitlinien oder Überwachungssysteme.
Unklar ist, warum sich der Pilz so stark verbreitet; diskutiert wird ein möglicher Zusammenhang mit dem Klimawandel. C. auris wurde erst 2009 entdeckt und 2022 von der WHO in die Liste besonders bedrohlicher Pilzarten aufgenommen.
Weiterführender Link:
https://www.aerzteblatt.de/search/result/7c65a9c6-a54b-4b6f-aadf-86e36f990eef?q
5. „Behavioural and cultural insights“ im Bundesgesundheitsblatt
Die September-Ausgabe des Bundesgesundheitsblatts behandelt, warum Menschen teils gesundheitsförderlich handeln und teils nicht – und wie Prävention gezielt an die Lebensbedingungen verschiedener Bevölkerungsgruppen angepasst werden kann. Herausgegeben wurde das Heft von Wissenschaftlerinnen des Robert Koch-Instituts, der Universität Erfurt und des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin.
Viele Volkskrankheiten wie Adipositas, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind vermeidbar, weshalb Prävention eine zentrale Rolle spielt. Neben individuellem Verhalten müssen dabei auch soziale und kulturelle Faktoren berücksichtigt werden, was die Grundlage des Ansatzes der Behavioural and Cultural Insights (BCI) bildet.
Mit der WHO-Resolution von 2022 hat sich Deutschland verpflichtet, BCI stärker in die Public-Health-Praxis einzubinden. Die aktuelle Ausgabe des Bundesgesundheitsblatts bietet dazu theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele, etwa aus den Bereichen Ernährung und Klimawandel, und plädiert dafür, BCI dauerhaft als wichtige Säule von Prävention und Gesundheitspolitik zu verankern.
Weiterführender Link:
https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Neuigkeiten-und-Presse/Meldungen/Archiv/2025-08-27_Bundesgesundheitsblatt.html?nn=16776970
6. DGKH: mikrobiologische Beprobung von flexiblen Endoskopen
Durch die Neuauflage der Anlage 8 der KRINKO-BfArM-Empfehlung ist derzeit verstärkt in Diskussion, mit welchen Methoden die Prozesswirkung im Rahmen der Qualitätssicherung der Aufbereitung & Lagerung flexibler Endoskope überprüft werden sollte.
Mit der Neuauflage der Anlage 8 der KRINKO-BfArM-Empfehlung wurde ein informativer Anhang zu Methoden der Produktkontrolle bei flexiblen Endoskopen ergänzt. Da es sich bei dem Anhang nicht um eine Empfehlung handelt, ergibt sich daraus keine rechtliche Verpflichtung. Problematisch ist jedoch, dass neue Grenzwerte für die mikrobiologische Überprüfung vorgeschlagen werden, die von den bisherigen deutschen Standards abweichen. Während bislang 20 KbE pro Kanal als Grenzwert galten, nennt die neue Fassung für das gesamte Endoskop eine Warngrenze von 20 KbE und eine Eingriffsgrenze von 100 KbE. Zudem wurden Mykobakterien und Legionellen neu in die Liste der Indikatororganismen aufgenommen, ohne dass klare Kriterien für deren Untersuchung angegeben werden.
Die DGKH sieht in diesem Bereich erheblichen Forschungsbedarf. International bestehen große Unterschiede bei Probennahme, Laborverfahren und Grenzwerten, sodass bislang keine wissenschaftlich gesicherte Grundlage für die neu beschriebenen Methoden vorliegt. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die bislang jährliche mikrobiologische Prozessüberprüfung ausreichend ist, da dadurch mögliche Belastungen durch Geräteschäden zu spät erkannt werden könnten. Grundsätzlich betont die DGKH, dass Patientensicherheit oberste Priorität haben muss. Gleichzeitig sollten Prüfmethoden verhältnismäßig, praktikabel und auf die Versorgungssicherheit abgestimmt sein, etwa durch einfache Verfahren mit Fokus auf zentrale Indikatoren und anlassbezogene Kontrollen.
Weiterführender Link:
https://www.krankenhaushygiene.de/informationen/1015
7. In eigener Sache: unsere Hygieneschulungen und -seminare
Möchten Sie Ihr hygienebeauftragtes Personal ausbilden? Wir bieten verschiedene Schulungen für die Aus- oder Weiterbildung von Hygienemultiplikatoren in unterschiedlichen Positionen im Online-Format an.
Die nächsten Termine der kommenden Kurse:
- Refreshertage für Hygienebeauftragten in stationärer und ambulanter Pflege (Link); zwei Tage; nächster buchbarer Kurs am 04.-05.11.2025
- Fortbildung zur/m Hygienebeauftragten in stationärer und ambulanter Pflege (Link); insgesamt 80 Unterrichtseinheiten, davon 60 in Videopräsenz; nächster buchbarer Kurs startet am 12.01.2026
- Ausbildung zur/m Hygienebeauftragten für psychiatrische Einrichtungen (Link); 24 Unterrichtseinheiten über vier Tage; nächster Kurs am 21.-22. & 28.-29.01.2026
- Fachkraft für Hygienesicherung nach DIN 13063 (Link); vier Tage; nächster Kurs am 12.-13.03. und 19.-20.03.2026
- Ausbildung zum/r Hygienebeauftragten MFA in der Augenheilkunde (Link); 24 Unterrichtseinheiten über vier Tage; nächster Kurs am 08.-09. & 15.-16.07.2026
Hier finden Sie unser gesamtes Seminarangebot: hygso.de/hygieneschulungen
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individuelle Beratung nicht ersetzen können!
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
Kommentare in kursiv.