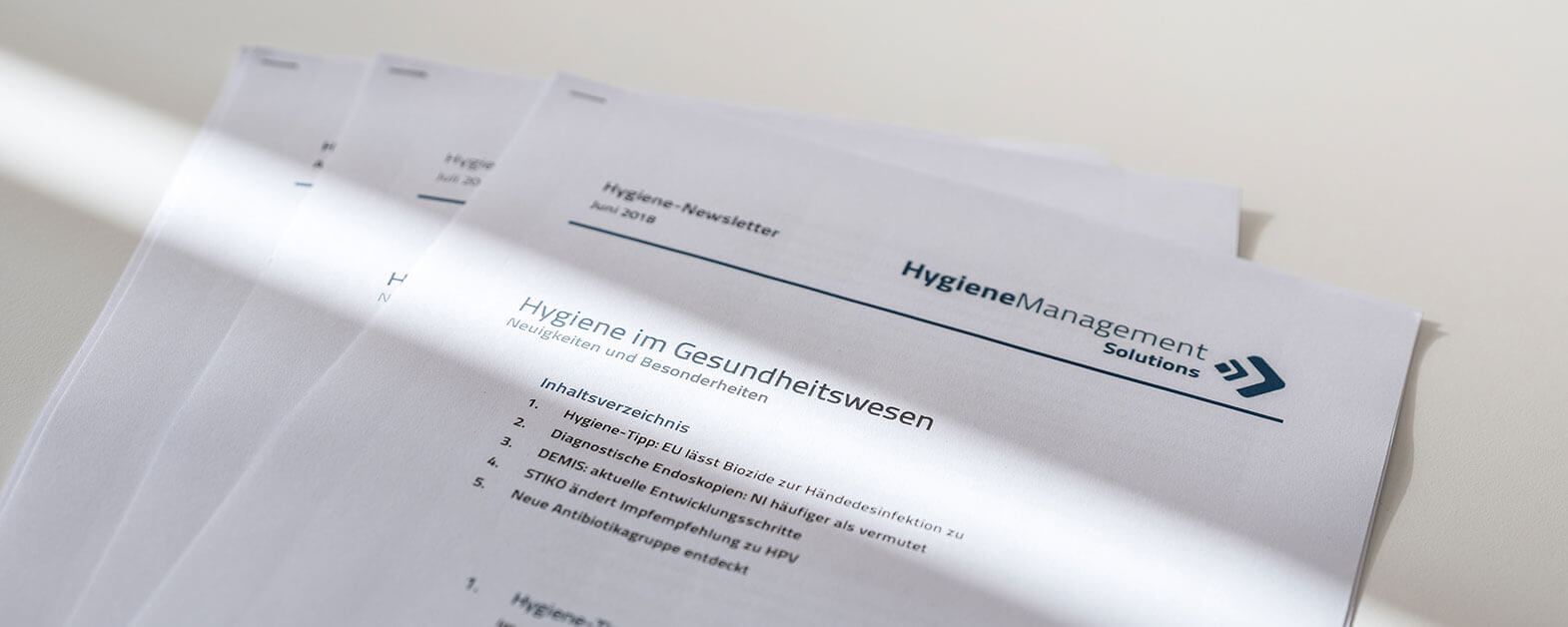HygSo-Hygienenews Juli - August 2025
1. KRINKO-Empfehlung zu Rehabilitationseinrichtungen
Die neue KRINKO-Empfehlung ist am 21.08.2025 erschienen und bietet klare Leitlinien für die Infektionsprävention in Reha-Einrichtungen. Eine strukturierte Risikoanalyse und darauf basierende Hygieneplanung sind zentrale Elemente, um Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Reha-Ziele nicht zu beeinträchtigen.
Weiterführender Link:
https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Krankenhaushygiene/KRINKO/Empfehlungen-der-KRINKO/Infektionspraevention-speziell/Tabelle_Infektionspraevention_Rehabilitationseinrichtungen.html
2. Hygiene-Tipp: Tischabdeckung im OP
Der neue DGKH-Hygienetipp äußert sich zur Wiederverwendung von OP-Abdeckmaterial.
Die KRINKO-Empfehlung zur Prävention postoperativer Wundinfektionen (2018) geht auf Abdeckmaterialien für den Instrumententisch nicht ausdrücklich ein. Allerdings ist eine sterile Abdeckung zwingend erforderlich, da der Tisch selbst nicht steril ist. Reine Baumwollmischgewebe erfüllen die Anforderungen, flüssigkeitsabweisend oder flüssigkeitsundurchlässig zu sein, nicht. Zudem entsteht eine erhöhte Partikelbelastung.
Neben Einwegmaterialien entsprechen jedoch beschichtete bzw. imprägnierte Baumwollmischgewebe-Tücher den Anforderungen der DIN EN 13795-1:2019-06. Diese Mehrwegprodukte können gemäß Herstellerangaben aufbereitet, d.h. gewaschen und sterilisiert, werden. Laut KRINKO sind solche beschichteten Baumwollmaterialien hinsichtlich Infektionsschutz gleichwertig zu Kunststoff-Einwegabdeckungen.
Weiterführender Link:
https://www.bdc.de/hygiene-tipp-tischabdeckung-im-op/?parent_cat=252
3. MRSA: mehr Infektionen in sozial benachteiligten Regionen
Eine aktuelle Untersuchung des Robert Koch-Instituts zeigt, dass die soziale Lage Einfluss auf das Risiko für Methicillin-resistente Staphylococcus-aureus-Infektionen hat.
Während Zusammenhänge zwischen sozioökonomischer Lage und Gesundheitsrisiken wie Krebs oder geringerer Lebenserwartung bekannt sind, war der Einfluss sozialer Faktoren auf antimikrobielle Resistenzen (AMR) in Deutschland bislang kaum untersucht. In der aktuellen Analyse wurden 47.244 gemeldete Fälle von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA), Carbapenem-resistenten Enterobacterales (CRE) und Acinetobacter spp. (CRA) aus den Jahren 2010 bis 2019 abgeglichen. MRSA-Infektionen machten dabei den Großteil der Fälle aus (n = 34.440).
Die Ergebnisse zeigen: In sozioökonomisch benachteiligten Regionen war die MRSA-Inzidenz deutlich höher (IRR: 4,77), insbesondere in Großstädten (IRR: 9,09) und dünn besiedelten ländlichen Regionen (IRR: 6,45). Der Zusammenhang war in dichter besiedelten ländlichen und urbanen Gebieten schwächer ausgeprägt.
Weiterführender Link:
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Mehr-MRSA-Infektionen-in-sozial-benachteiligten-Regionen-Deutschlands-459485.html?searchtoken=hsyAJrV1dJbahpn8VhYTz2fI0mQ%3d&starthit=1
4. Gesunde Ernährung schützt Darm besser als Stuhltransplantation
Eine ausgewogene Ernährung kann die Regeneration des Darms nach einer Antibiotikatherapie unterstützen und die Widerstandskraft gegenüber Infektionskrankheiten verbessern. Dies belegen tierexperimentelle Untersuchungen zu Darminfektionen, bei denen die aktuell verbreitete Stuhltransplantation nur dann erfolgreich war, wenn die Mäuse zuvor gesund ernährt wurden.
Antibiotikabehandlungen stören das Darmmikrobiom und begünstigen die Ausbreitung schädlicher Bakterien wie Clostridioides difficile, die schwere Durchfallerkrankungen verursachen können. Eine Studie von Eugene Chang (University of Chicago) zeigt, dass nicht nur Antibiotika, sondern auch die Ernährung eine wichtige Rolle bei der Erholung des Darmmikrobioms spielt.
Mäuse, die vor der Antibiotikabehandlung mit einer westlichen Ernährungsweise – reich an Fett und Zucker, arm an Ballaststoffen – ernährt wurden, erholten sich langsamer und weniger vollständig als Mäuse mit artgerechter Ernährung. Nach 28 Tagen erreichten die erstgenannten nur 16 % der ursprünglichen mikrobiellen Vielfalt, die artgerecht ernährten Mäuse hingegen 69 %. Auch Kohlenhydratstoffwechsel und die Produktion wichtiger Stoffwechselprodukte normalisierten sich bei gesunder Ernährung schneller.
Die fäkale Mikrobiomtransplantation wirkte nur bei artgerecht ernährten Tieren, bei westlicher Kost zeigte sie kaum Effekt. Zudem blieben nur die artgerecht ernährten Mäuse nach einer Infektion mit Salmonella Typhimurium gesund, während die anderen eine starke bakterielle Besiedlung und Entzündungen entwickelten.
Die Studie unterstreicht, dass eine gesunde Ernährung entscheidend für die Wiederherstellung des Darmmikrobioms und die Infektionsabwehr ist. Ob sich diese Ergebnisse auf Menschen übertragen lassen, bleibt noch zu klären.
Weiterführender Link:
https://www.aerzteblatt.de/news/rubriken/medizin/antibiotika-gesunde-ernahrung-konnte-darm-effektiver-schutzen-als-stuhltransplantation-37142420-d597-43d3-8738-b37477f8f221
5. Rechtliche Verantwortung: Patientensicherheit und Hygiene
Herr Dr. jur. Torsten Nölling, Fachanwalt für Medizinrecht, beschreibt im Ärzteblatt die rechtlichen Zusammenhänge rund um Hygienefehler und Haftungsrisiken. Eine prägnante Wiederholung der wichtigsten Aspekte.
Die Sicherheit von Patientinnen und Patienten hat in medizinischen Einrichtungen oberste Priorität. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist die konsequente Einhaltung hoher Hygienestandards. Da Krankenhausinfektionen medizinisch schwer zu behandeln sind und rechtlich strengen Haftungsregelungen unterliegen, kommt der Hygiene besondere Bedeutung zu.
Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, ihre Patientinnen und Patienten nach dem jeweils geltenden medizinischen Standard zu behandeln. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Behandlungsvertrag (§§ 630a ff. BGB) gegenüber dem Krankenhausträger sowie aus dem Deliktsrecht (§§ 823 ff. BGB) gegenüber den Behandelnden selbst. Kern der Verpflichtung ist eine sorgfältige, fachgerechte Behandlung.
Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn anerkannte Regeln der ärztlichen Kunst oder gesicherte medizinische Erkenntnisse nicht beachtet werden. Nach § 630a Abs. 2 BGB zählen hierzu auch Hygienestandards. Unterlassene Händedesinfektionen oder unzureichend gereinigte Instrumente sind klassische Beispiele für Verstöße.
Im Haftungsprozess müssen Patientinnen und Patienten zunächst den Fehler, den daraus resultierenden Gesundheitsschaden sowie den ursächlichen Zusammenhang nachweisen. Da ihnen jedoch meist Fachwissen und Einblick in interne Abläufe fehlen, ist das insbesondere bei versteckten Hygienemängeln kaum möglich. Patienten müssen lediglich pauschal einen Hygieneverstoß behaupten. Daraufhin trifft die Gegenseite – Krankenhaus oder behandelnde Person – eine erweiterte Darlegungspflicht. Diese umfasst unter anderem Hygiene- und Reinigungspläne oder Nachweise, dass die Infektion nicht auf mangelnde Hygiene zurückzuführen ist.
Mit dieser Rechtsprechung wächst die Bedeutung der Dokumentation. Nach Vorlage der Unterlagen liegt die Beweislast zwar weiterhin bei den Patientinnen und Patienten, sie können jedoch nun mit konkreteren Informationen argumentieren.
Eine besondere Konstellation tritt ein, wenn sich ein voll beherrschbares Risiko realisiert (§ 630h Abs. 1 BGB). In solchen Fällen wird ein Behandlungsfehler vermutet und die Beweislast kehrt sich um. Voll beherrschbare Risiken sind Gefahren, die eindeutig dem organisatorischen Bereich des Krankenhauses zuzurechnen sind, wie beispielsweise mangelhafte Desinfektion von Flächen oder nicht sterile Medizinprodukte.
Um Haftungsrisiken zu minimieren, müssen Behandelnde nachweisen können, dass alle notwendigen organisatorischen und technischen Maßnahmen ergriffen wurden. Absolute Keimfreiheit ist zwar unmöglich, doch wenn Infektionen auf einem Bereich entstehen, der durch Hygiene vollständig kontrollierbar wäre, greift die Beweislastumkehr.
Daher gilt Prävention als effektivster Schutz. Besonders wichtig ist die Umsetzung der Empfehlungen der KRINKO beim Robert Koch-Institut. Nach § 23 Abs. 3 IfSG gilt die Einhaltung dieser Vorgaben als ausreichend, um die notwendigen Schutzmaßnahmen zu erfüllen. Wer sie konsequent befolgt, kann sich auch im Haftungsfall solide verteidigen.
Die Beachtung von Hygieneregeln schützt nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern reduziert zugleich rechtliche Risiken. Ärztinnen und Ärzte sollten die KRINKO-Empfehlungen daher fest in ihre Praxis integrieren. Lückenlose Dokumentation, regelmäßige Fortbildungen und ein strukturiertes Hygienemanagement sind entscheidend, um auch im Streitfall abgesichert zu sein.
Weiterführender Link:
https://www.aerzteblatt.de/search/result/bdbdbffe-ce2f-4e55-b62f-5d27b4473d52?q=
6. In eigener Sache: unsere Hygieneschulungen und -seminare
Möchten Sie Ihr hygienebeauftragtes Personal ausbilden? Wir bieten verschiedene Schulungen für die Aus- oder Weiterbildung von Hygienemultiplikatoren in unterschiedlichen Positionen im Online-Format an.
Die nächsten Termine der kommenden Kurse:
- Fortbildung zur/m Hygienebeauftragten in stationärer und ambulanter Pflege (Link); insgesamt 80 Unterrichtseinheiten, davon 60 in Videopräsenz; nächster Kurs startet am 12.01.2026
- Refreshertage für Hygienebeauftragten in stationärer und ambulanter Pflege (Link); zwei Tage; nächster Kurs am 07.-08.10.2025
Hier finden Sie unser gesamtes Seminarangebot: hygso.de/hygieneschulungen
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individuelle Beratung nicht ersetzen können!
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
Kommentare in kursiv.