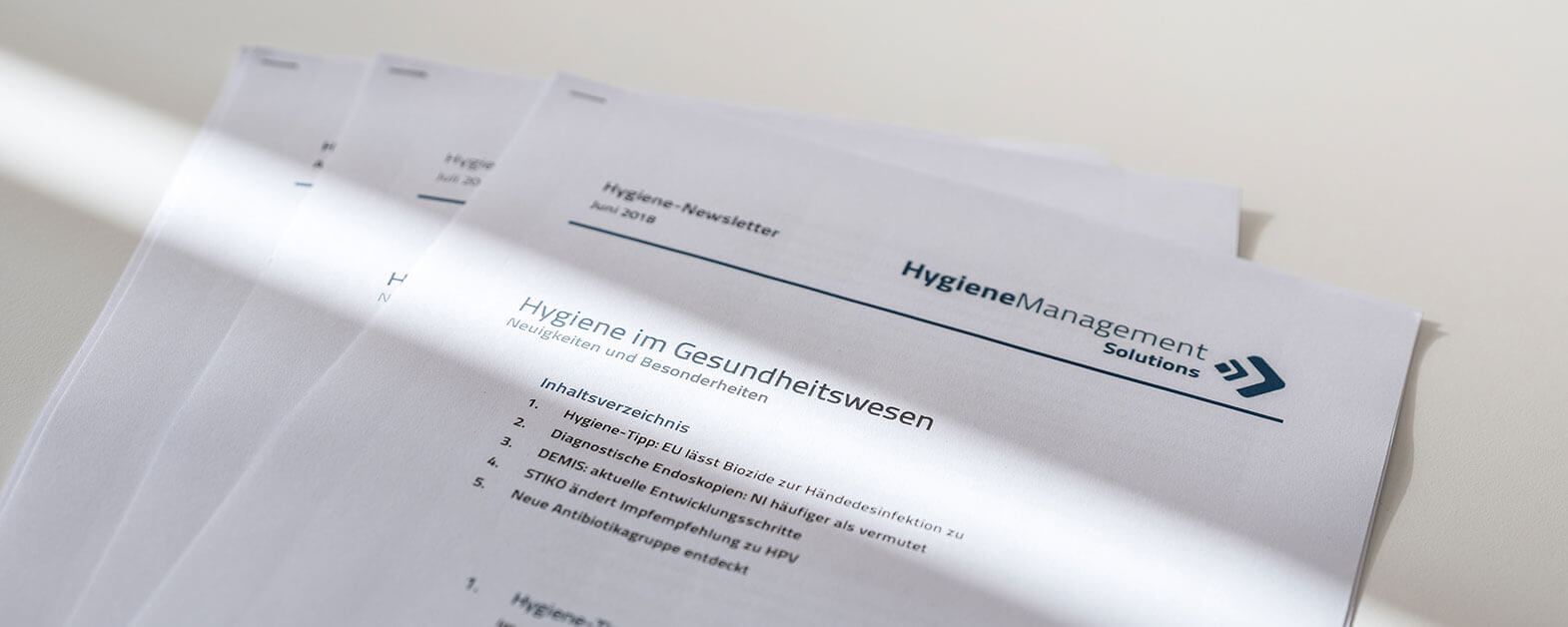HygSo-Hygienenews November - Dezember 2024
1. „Hygienebeauftragte(r) in stationärer & ambulanter Pflege“ erneuert
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene (SGKH) hat ihre Leitlinie „Hygienebeauftragte(r) in stationärer und ambulanter Pflege – Aufgaben & Anforderungen an die Fortbildung“ im Dezember 2024 aktualisiert.
In der Hygiene der ambulanten und stationären Pflege außerhalb von Krankenhäusern ist momentan viel Bewegung. Auch die DGKH aktualisiert ihre Empfehlungen. Die neue Fassung ersetzt die entsprechende Leitlinie aus 2012 und beinhaltet vor allem drei wesentliche Anpassungen bzw. Verdeutlichungen:
- Hygienebeauftragte in stationärer Pflege und Hygienebeauftragte in ambulanter Pflege sollen gleichermaßen fachlich fortgebildet sein
- Pflegefachkraft ist keine Voraussetzung, um Hygienebeauftragte/r zu sein
- Reduzierung des Fortbildungsumfangs auf 80 Unterrichtseinheiten (inkl. 20 UE Hausarbeiten) statt mind. 200 UE (zzgl. Praktikum)
Insgesamt berücksichtigen die Anpassungen die Entwicklungen im Gesundheitswesen. Sie zeigen eine stärkere Fokussierung auf Praxisnähe und damit auch auf die Umsetzung der Hygienemaßnahmen in der täglichen Bewohner- bzw. Patientenversorgung.
Weiterführender Link:
https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/DGKH_Leitlinie_HM_24_online%20vorab.pdf
2. Hygiene-Tipp: Fehlender Dichtsitz bei Masken mit Ohrbändern
Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) hat frühzeitig und wiederholt während der Corona-Pandemie auf Probleme bei Masken hingewiesen, insbesondere auf den oft mangelhaften Dichtsitz. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass FFP2-Masken mit Ohrschlaufen besonders häufig keinen sicheren Dichtsitz bieten, auch wenn sie nach geltenden Standards (z.B. EN 149) geprüft wurden.
Im Safety Gate System der EU (ehemals RAPEX) wurden in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 84 Fälle von beanstandeten Masken erfasst, von denen 78 speziell Masken mit Ohrschlaufen betrafen. Eine Untersuchung aus England zeigte im März 2023, dass lediglich zwei von 90 getesteten Masken mit CE-Kennzeichnung und Ohrschlaufen die Anforderungen an den Dichtsitz erfüllten. Ähnliche Befunde wurden auch aus Frankreich und anderen Ländern gemeldet.
Empfehlungen der Hygiene-Tipp-Autoren der DGKH:
- FFP2-Masken mit Ohrschlaufen grundsätzlich vermeiden. Stattdessen Modelle mit Kopfband verwenden; dabei auf die CE-Kennzeichnung achten.
- Jegliche Masken mit Ohrschlaufen im OP-Bereich überhaupt nicht verwenden.
Weiterführender Link:
https://www.bdc.de/hygiene-tipp-keine-masken-mit-ohrbaendern-im-op/?parent_cat=250
3. DGKH-Stellungnahme zur Ausstattung mit Hygienefachpersonal
Mit einer Ergänzung der Stellungnahme zur KRINKO-Empfehlung „Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen“ wendet sich die DGKH erneut an die KRINKO und bittet um Überprüfung der Empfehlung.
Die DGKH hat bereits im Mai 2023 die KRINKO-Empfehlung zur Prävention nosokomialer Infektionen kritisch hinterfragt und eine Überprüfung gefordert. Diese Forderung wird nun erneut bekräftigt und um einen bislang wenig beachteten Aspekt erweitert.
Die KRINKO hat in ihrer Empfehlung erstmals und ohne Evidenz eine Definition für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen aufgestellt, die hinsichtlich der medizinischen Versorgung mit Krankenhäusern vergleichbar sind. Zu diesen Einrichtungen zählen laut KRINKO solche, in denen Patienten:
- intensivmedizinisch betreut werden (z.B. Beatmung),
- invasive Techniken benötigen (z.B. zentrale Venenkatheter),
- operativ behandelt werden, oder
- systemische Chemotherapien erhalten.
Für andere Rehabilitationseinrichtungen und akutmedizinische Bereiche der Psychosomatik stuft die KRINKO das Infektionsrisiko in der Regel als sehr niedrig ein.
Weiterführender Link:
https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/288_289_DGKH_Stellungnahme_HM_12_24.pdf
4. DGKH: Aufbereitung semikritischer Medizinprodukte
Die Aufbereitung semikritischer Medizinprodukte, wie endovaginaler und endorektaler Ultraschallsonden, wird derzeit kontrovers diskutiert. Diese Fokussierung greife jedoch zu kurz, da semikritische Medizinprodukte auch in anderen Bereichen, wie der Zahnmedizin, weit verbreitet seien.
Diese Debatte wird aus der Sicht der DGKH durch Missverständnisse und selektive Aufmerksamkeit geprägt. Nach intensiver Beratung wurde speziell zu zwei Themen Stellung genommen: der Validierung manueller Verfahren mit abschließender Desinfektion und der Verwendung von Hüllen.
Weiterführender Link:
https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/DGKH_Mitteilung_Aufb%20Semikr_HM_24_online%20vorab%282%29.pdf
5. Hygiene-Tipp: Niesen während der Operation
Laut gängiger Meinung sollte beim Niesen der Blick auf die Wunde gerichtet werden, damit eventuell austretende Tröpfchen durch die nicht vollständig abschließenden Ränder der OP-Maske nach hinten entweichen können. Studien, die diese Annahme belegen, sind jedoch nicht bekannt.
Bereits 2007 kam eine experimentelle Studie (Granville-Chapman J, Dunne RL. Excuse me. BMJ. 2007, 22;335: 1293) zu einem abweichenden Ergebnis. Dabei wurde ein Chirurg mit Gesichtsmaske getestet, der eine geringe Menge Wasser im Mund hielt und durch gemahlenen Pfeffer zum Niesen gebracht wurde. Mithilfe einer Stroboskoplampe wurde die Tröpfchenverteilung vor dunklem Hintergrund sichtbar gemacht. Es zeigte sich, dass wenige Tröpfchen seitlich aus der Maske austraten und hinter dem Kopf des Chirurgen landeten. Der Großteil der Tröpfchen war jedoch vor der Brust nachweisbar.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich ein Chirurg beim Niesen mit Maske von der Wunde abwenden sollte – ähnlich wie es im privaten Alltag instinktiv beim Abwenden vom Gesprächspartner geschieht.
Weiterführender Link:
https://www.bdc.de/hygiene-tipp-wohin-waehrend-der-operation-niesen/?parent_cat=252
6. Behördliche Überwachung von Arztpraxen
Die Broschüre „Hygiene und Medizinprodukte – Behördliche Überwachung von Arztpraxen“ bietet praktische Orientierungshilfen zu Vorschriften des Infektionsschutzes sowie Medizinprodukte- und Arbeitsschutzrechts. Sie richtet sich an Personen, die sich über Arten, Zuständigkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen der behördlichen Überwachung informieren oder auf eine Überprüfung vorbereiten möchten.
Arztpraxen sehen sich zunehmend mit der behördlichen Überwachung ihres Hygienemanagements, des Umgangs mit und der Aufbereitung von Medizinprodukten sowie des Arbeitsschutzes konfrontiert. Diese Überwachung dient nicht nur der Qualitätssicherung, sondern auch der Beratung und dem Austausch. Die Anforderungen variieren jedoch oft zwischen den Bundesländern, was durch die Zuständigkeit verschiedener Behörden zusätzlich erschwert wird.
Ein Großteil der Vorgaben für Arztpraxen fällt in die Bereiche „Infektionsschutzrecht“, „Medizinprodukterecht“ und „Arbeitsschutzrecht“. Während einige Regelungen klar einem dieser Bereiche zugeordnet werden können, überschneiden sich andere oder greifen ineinander.
Die Broschüre stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten und Schwerpunkte dieser Themenfelder dar und soll dabei helfen, sich gezielt auf die behördliche Überwachung vorzubereiten.
Weiterführender Link:
https://www.hygiene-medizinprodukte.de/download/behoerdliche-ueberwachung-von-arztpraxen
7. Vogelgrippe: neue Anpassung an den Menschen
Eine neue Entwicklung bei der Vogelgrippe sorgt für Besorgnis: In Kanada hat sich ein Jugendlicher mit dem Virus H5N1 infiziert und ist schwer erkrankt. Untersuchungen legen nahe, dass sich der Erreger stärker an den Menschen angepasst hat.
Der Fall des Jugendlichen, dessen Infektionsquelle unbekannt ist und der keinen Kontakt zu Wildvögeln, Geflügel oder Rindern hatte, zeigt drei signifikante genetische Veränderungen im Virus. Diese betreffen das Hämagglutinin-Protein (HA-Protein) und erleichtern die Bindung an menschliche Atemwegsrezeptoren.
Eine im Fachjournal „Science“ veröffentlichte Laborstudie bestätigt, dass bereits eine einzelne Mutation im HA-Protein ausreicht, um die Bindung an menschliche Rezeptoren zu verbessern. Wissenschaftler modifizierten gezielt die Rezeptorbindungsregion des H5N1-Virus, das zuvor in Texas nachgewiesen wurde. Mit einer zweiten Mutation zeigte das Virus sogar pandemisches Potenzial, vergleichbar mit dem H1N1-Virus der Schweinegrippe 2009. Allerdings wurden diese Tests nur an rezeptorähnlichen Strukturen und nicht in lebenden Zellen durchgeführt. Ob solche Mutationen in der Natur auftreten und tatsächlich eine Pandemie auslösen könnten, bleibt unklar.
Angesichts der starken Verbreitung des Virus in den USA fordert Martin Beer vom Friedrich-Loeffler-Institut verstärkte Kontrollmaßnahmen in Nutztierbeständen, insbesondere bei Rindern, sowie besseren Schutz für Beschäftigte in betroffenen Betrieben. Zudem sind engmaschige Überwachungs- und Früherkennungssysteme notwendig. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung wurde bisher nicht festgestellt.
Weiterführender Link:
https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/h5n1-was-der-fall-eines-infizierten-kanadischen-jugendlichen-bedeutet-110155457.html
8. Nosokomiale Candida-Infektionen
Die globale Ausbreitung medikamentenresistenter Pilze nimmt zu, wie eine Studie am Beispiel von Candida parapsilosis zeigt. Resistente Erreger stellen eine wachsende Gefahr dar, die strikte Infektionskontrollmaßnahmen erfordert. Besonders hospitalisierte Patienten mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdet.
Ein besorgniserregender Trend ist die zunehmende Resistenz von Stämmen gegen Azole wie Fluconazol, was die Behandlung erschwert und die Sterblichkeit invasiver Infektionen deutlich erhöht. Laut der Studie sind Infektionen mit C. parapsilosis weltweit eine der häufigsten Ursachen für systemische Candida-Infektionen und inzwischen eine häufige Ursache katheterassoziierter Blutbahninfektionen bei Erwachsenen.
Die Forschenden untersuchten einen lang andauernden Ausbruch in Berliner Gesundheitseinrichtungen. Dabei identifizierten sie einen genetisch einheitlichen Stamm, der sich 2018 bis 2022 von Mensch zu Mensch und zwischen Einrichtungen verbreitete. Genetische Analysen zeigten eine Verwandtschaft dieser Stämme mit Isolaten aus Ländern wie der Türkei, Kanada und Südkorea. Um die Erreger effizienter zu typisieren, entwickelten die Wissenschaftler ein kostengünstiges Verfahren namens Multilocus Sequence Typing (MLST), das eine schnelle und präzise Identifikation der Stämme ermöglicht.
Das Team betont die Bedeutung einer zügigen Erkennung von Pilzinfektionen und Resistenzen, um die Weiterverbreitung zu verhindern. Kliniken ohne ausreichende Ressourcen sollten bei Verdacht auf einen Ausbruch spezialisierte Referenzzentren kontaktieren. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit strikter lokaler Infektionskontrollen und globaler Überwachung, um die Verbreitung von C. parapsilosis einzudämmen.
Weiterführender Link:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/155872/Nosokomiale-Candidainfektionen-sind-ein-wachsendes-Gesundheitsproblem
9. Rifaximin bedroht Reserveantibiotikum Daptomycin
Antibiotikaresistenzen können auf unvorhergesehene Weise entstehen, wie eine aktuelle Publikation zeigt. Eine australische Forschungsgruppe fand heraus, dass Resistenzen gegen das Reserveantibiotikum Daptomycin möglicherweise durch den präventiven Einsatz des nicht verwandten Antibiotikums Rifaximin ausgelöst werden.
Multiresistente Infektionen durch Vancomycin-resistenten Enterococcus faecium (VRE) sind lebensbedrohlich. In solchen Fällen bleibt oft nur Daptomycin, das durch Störung der Zellmembran grampositiver Bakterien deren Abtötung bewirkt. Dennoch wurden wiederholt unerklärliche Resistenzen gegen Daptomycin beobachtet. Die Studie zeigt, dass Rifaximin, ein Antibiotikum zur Vorbeugung hepatischer Enzephalopathie bei Leberzirrhose-Patienten, bei VRE Kreuzresistenzen gegen Daptomycin hervorrufen kann.
Untersuchungen ergaben, dass Rifaximin Aminosäureänderungen in der RNA-Polymerase des Bakteriums verursacht. Diese führen zu einem Umbau der Zellmembran, wodurch Daptomycin seine Wirkung verliert. Bisher galt Rifaximin als risikoarmes Antibiotikum in Bezug auf Resistenzbildung. Die Forschenden warnen jedoch, dass dessen weit verbreiteter Einsatz die Wirksamkeit von Daptomycin gefährden könnte – einer der letzten Therapieoptionen gegen multiresistente Keime.
Die Ergebnisse betonen, dass unerwartete Kreuzresistenzen globale Bemühungen untergraben können, die Effektivität von Reserveantibiotika langfristig zu sichern.
Weiterführender Link:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/156279/Prophylaktischer-Einsatz-von-Rifaximin-bedroht-Reserveantibiotikum-Daptomycin
10. In eigener Sache: unsere Hygieneschulungen und -seminare
Möchten Sie Ihr hygienebeauftragtes Personal ausbilden? Wir bieten verschiedene Schulungen für die Aus- oder Weiterbildung von Hygienemultiplikatoren in unterschiedlichen Positionen im Online-Format an.
Die nächsten Termine der kommenden Kurse:
- Fortbildung zur/m Hygienebeauftragten in stationärer und ambulanter Pflege (Link); berücksichtigt schon die neue DGKH-Leitlinie (siehe Abschnitt 1); insgesamt 60 Unterrichtseinheiten in Videopräsenz; übernächster Kurs startet am 18.03.2025
- Refreshertage für Hygienebeauftragten in stationärer und ambulanter Pflege (Link); zwei Tage; nächster Kurs am 28.-29.01.2025
- Fachkraft für Hygienesicherung nach DIN 13063 (Link); vier Tage; nächster Kurs am 17.-18.06. und 24.-25.06.2025
Hier finden Sie unser gesamtes Seminarangebot: hygso.de/hygieneschulungen
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individuelle Beratung nicht ersetzen können!
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
Kommentare in kursiv.